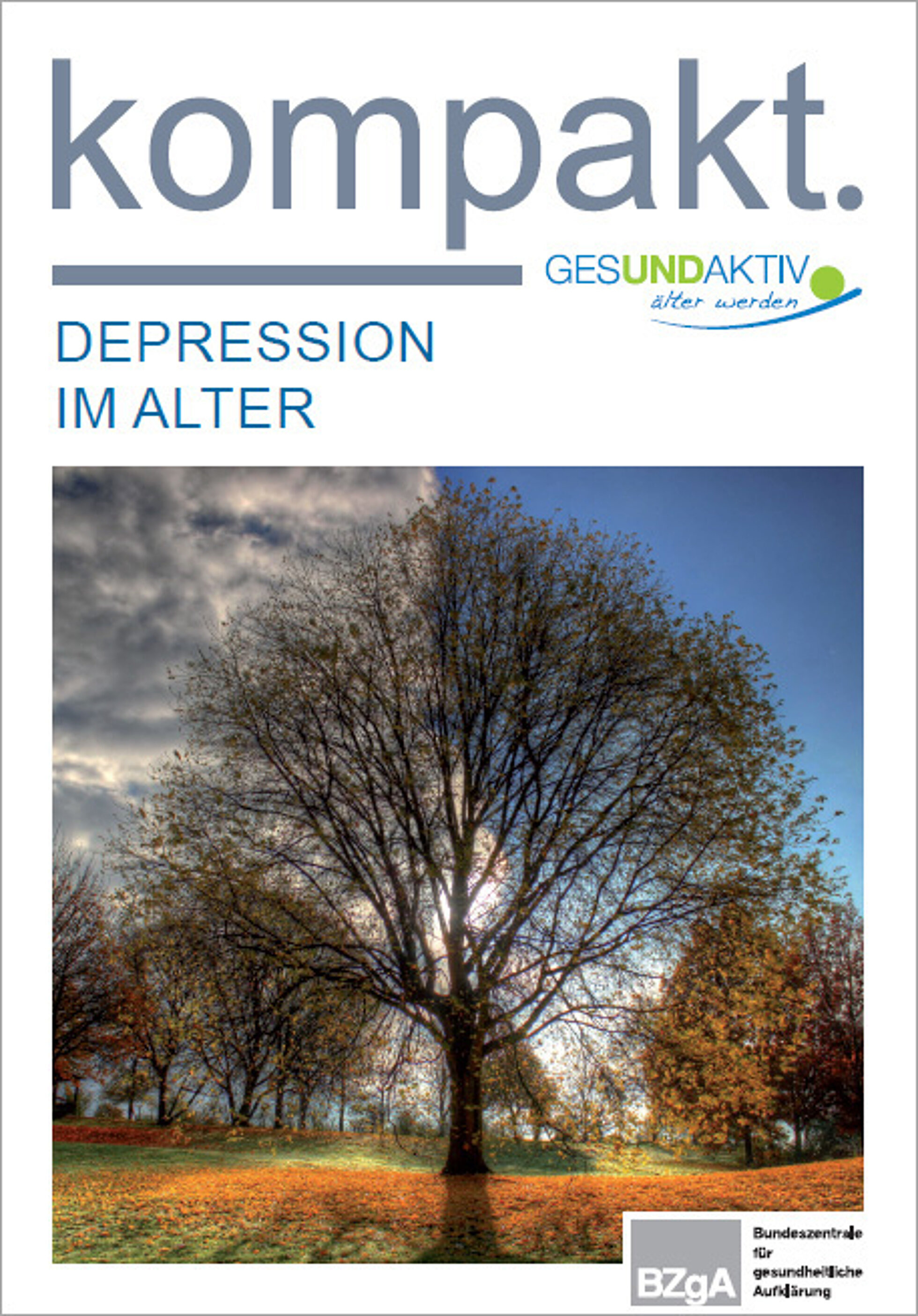Die Krankheit Depression hat viele Gesichter und unterschiedliche Verläufe. Berichte von Betroffenen und Angehörigen können Ihnen helfen, die Erkrankung besser zu verstehen und zu erkennen, ich bin nicht allein.
Erfahrungsberichte
Manfred Bieschke-Behms und Christina Merseburger geben einen Einblick in ihr Leben mit der Depression. Karl Heinz Möhrmann schildert aus der Perspektive eines Angehörigen, wie er mit der Erkrankung seiner Frau umgeht.
Manfred Bieschke-Behms (70) Blick auf seine Kindheit und Jugend fällt schmerzvoll aus: Der Vater verlässt die Familie früh, der Stiefvater habe ihn stets spüren lassen, unerwünscht, nutzlos und ein Versager zu sein. Noch heute leidet er gelegentlich an den Folgen wochenlangen sexuellen Missbrauchs durch einen pädophilen Mann. Gerade mal 13 Jahre alt, versucht er sich erstmals das Leben zu nehmen. Weitere Versuche sollten folgen.
Nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann geht der junge Mann erfolgreich seinen beruflichen Weg bei einer großen Versicherungsgesellschaft, wird dort schließlich zum stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Die Depression geht den Weg mit, wird zu seinem ständigen und oft kaum zu ertragenden Begleiter. Irgendwann fühlt er sich an seinem Arbeitsplatz hochgradig überfordert. „Selbst banale Tätigkeiten waren plötzlich für mich unüberwindbar und nicht zu bewältigen“, berichtet er. Von Menschen zieht er sich zurück, schafft es teilweise nicht, die Wohnung zu verlassen. Nur die völlige Isolation ist für ihn zu ertragen. Und zwischendrin gibt es immer wieder den Gedanken, diesem „Leben“ ein Ende zu setzen.
Weil Manfred Bieschke-Behm keinen anderen Ausweg für sich sieht, weist er sich selbst in Kliniken ein. Diese wie auch verordnete Klinikaufenthalte werden von ihm mit Blick auf die gesuchte Hilfe unterschiedlich bewertet. Über mehrere Jahre verteilte Psychotherapien – von der Verhaltenstherapie über die analytische Psychotherapie bis hin zur Gestaltungs- und Bewegungstherapie – helfen, den Allgemeinzustand zu verbessern. Die Medikamente, die er bekommt, haben ihm Entschleunigung gebracht, sagt er im Rückblick. „Als alleinige Behandlungsform reichten diese aber nicht aus. Manchmal habe ich mich wie eine Marionette gefühlt, an deren Fäden stets irgendwelche anderen ziehen“, berichtet Bieschke-Behm. „Auch wenn es Phasen gab, in denen ich mich wohl fühlte, die ich genießen konnte, hielten Gefühle von Glück und Zufriedenheit nie lange an“, fasst er zusammen. Auch für seinen Partner, mit dem er jetzt bald 50 Jahre zusammenlebt, war das keine leichte Situation. Nach 25 Jahren reißt ihn seine Krankheit schließlich ganz aus seinem beruflichen Umfeld heraus. Der damals 49-Jährige scheidet aus dem Arbeitsleben aus – erneut Therapien, begleitet von langfristiger Krankschreibung hin zur Verrentung.
Im Jahr darauf trifft der heute 70-jährige Berliner auf den für ihn optimal geeigneten Verhaltenstherapeuten. Er lernt zum ersten Mal, sich selbst wertzuschätzen und zu lieben – für ihn bislang ein eher unbekanntes Gefühl. Ein Leben ohne Angst vor dem Gestern, Heute und Morgen zu führen, hatte er sich nicht vorstellen können. Nicht zuletzt ist er heute in der Lage, mit seiner schmerzvollen Vergangenheit friedvoll zu leben. Er könne verzeihen und sei fähig, seinem Leben einen Sinn zu geben, so Manfred Bieschke-Behm.
In dieser entscheidenden Zeit der Veränderung ist ihm eines klar geworden: „Andere können mir zwar einen Weg zeigen“, sagt er, „gehen muss ich ihn letzten Endes allein.“ Er ist ihn gegangen, Schritt für Schritt – selbstbestimmt, trotz vieler Zweifel und so mancher Rückschläge. Er sagt: „Der Hauptmieter bin ich, und die Depression ist der Untermieter. Ich bestimme die Spielregeln. Lange Zeit war es umgekehrt.“ Ganz vertreiben konnte er den unliebsamen „chronischen“ Mitbewohner nicht, er sei heute aber in der Lage, diesen zumindest in Schach zu halten, erklärt er lächelnd. “Ich fühle mich von der Krankheit Depression nicht befreit, aber von ihr entfernt.“
Irgendwann entdeckt Manfred Bieschke-Behm die Selbsthilfe für sich – das Beste, was ihm passieren konnte, betont er. Zunächst als Mitglied und inzwischen als Gruppenleiter ist er seit vielen Jahren aktiv dabei. Er leitet Seminare, Workshops und zur Zeit zwei Selbsthilfegruppen, zum einen unter der Überschrift DENKEN-FÜHLEN-HANDELN, zum anderen unter dem Titel KREATIVES SCHREIBEN. Er hat ein Methodenbuch zum Thema Lebendige Gruppenarbeit und einen Ratgeber für Angehörige/Betroffene geschrieben. Die Arbeit insgesamt gibt ihm die Möglichkeit, seine Kreativität zu entfalten und vor allem anderen zu zeigen, dass es möglich ist, der Krankheit Depression die Macht zu entziehen, die ihr nicht zusteht. Um dorthin zu gelangen, war u. a. professionelle Hilfe erforderlich. „Wenn ich gewusst hätte, dass es Helfende gibt, hätte ich eher danach gesucht“, sagt Manfred Bieschke-Behm. Die Bereitschaft sich helfen zu lassen, sei allerdings Voraussetzung. „Auch ich musste lernen, Hilfe anzunehmen!“
„Ich hatte Situationen, in denen ich selbst gesagt hab‘, jetzt muss ich in die Klinik.“ Einmal sei sie dort gelandet und wisse eigentlich bis heute nicht, wie es dazu kam. Ursprünglich habe sie nur einen Stadtbummel machen wollen. An vielen Tagen traute sich Christina Merseburger erst gar nicht aus dem Haus, andere gab es, an denen sie den Weg kaum hinein schaffte. Und dann waren da auch immer wieder die Momente, da wollte sie nicht mehr leben. Wenn ein Auto an ihr vorbeifuhr, schoss ihr der Gedanke durch den Kopf: „Das würde jetzt passen.“ Dann aber dachte sie „an den armen Fahrer“, und das hielt sie schließlich davon ab, sich vor den Wagen zu werfen, wie sie sagt.
Wann es genau angefangen hat, daran erinnert sich die heute 71-Jährige nicht genau. Das müsse wohl so Mitte der 70er gewesen sein. Sie arbeitete damals bei der Post und lebte mit Ehemann, der Schwiegermutter und den 1974 geborenen Zwillingen in Leipzig, auf engstem Raum - keine ungewöhnliche Wohnsituation in der damaligen DDR, wie sie schildert. Es begann mit Appetitlosigkeit, entsprechend nahm sie mehr und mehr ab. Hausarbeit und Versorgung der Kinder wurden zur Last. Es kam der Zeitpunkt, an dem sie das Gefühl hatte, den Alltag nicht mehr bewältigen zu können. Selbst die geliebte Tätigkeit bei der Post fiel von Tag zu Tag schwerer. Vielfach schaffte sie es gar nicht erst hinzugehen, blieb stattdessen im Bett.
Mitte der 80er erlitt Christina Merseburger einen erneuten Zusammenbruch. Sie suchte erstmalig eine Tagesklinik auf. Verordnet wurden ihr da Autogenes Training, Sauna und Gruppentherapie. Gerade mit Letzterem tat sie sich schwer. Über sich zu reden, das hatte sie nie gelernt. Über Gefühle zu sprechen, sei zu der Zeit ja auch nicht üblich gewesen, erinnert sie sich. Beinahe erleichtert war sie, als 1987 eine rheumatoide Arthritis diagnostiziert wurde. Das sei wenigstens „etwas Greifbares“ gewesen, vor allem, wenn sie mitbekam, wie selbst Ärzte sich hinter vorgehaltener Hand über Patienten mit psychischen Problemen kritisch äußerten. „Eben noch eine andere Zeit“, wie sie sagt.
2015 gibt es den völligen Zusammenbruch. „Es ging nichts mehr“, erzählt sie. „Verstand und Empfinden haben einfach nicht mehr zusammengearbeitet. Ich konnte das nicht mehr zusammenbringen.“ Selbst der Bewegungsapparat versagte. Wieder einmal geht es nach Leipzig in die Klinik. Es folgte eine Kombination aus medikamentöser Behandlung und psychotherapeutischen Maßnahmen. Die entscheidende Wendung allerdings brachte für sie die Elektroheilbehandlung (auch „Elektrokonvulsionstherapie“), die in 2017 durchgeführt wurde. Diese Behandlungsform wird vor allem bei schweren oder behandlungsresistenten Depressionen eingesetzt.
Seitdem schaut Christina Merseburger fröhlich in die Zukunft – ein für sie bislang unbekanntes, doch wunderbares Gefühl. „Zum ersten Mal denke ich, wie stark ich doch eigentlich bin“, sagt sie. Dass sie zu solchen Gefühlen überhaupt fähig ist, das hat sie in der Gesprächstherapie erst mühsam lernen müssen. Was ihr überdies inzwischen viel Kraft gibt: Sie hat gelernt, Vertrauen aufzubauen. Ohne dieses, besonders den Ärzten und Therapeuten gegenüber, hätte es den Neuanfang auch nicht gegeben, so Christina Merseburger. Während sie sich obendrein früher für ihre psychischen Probleme und ihr „Versagen“ geschämt hat, steht sie heute bewusst dazu. Ganz offen kann sie über diese als auch über ihre Krankheit sprechen. „Was die anderen denken, ist mir egal. Ich steh‘ zu mir und meinen Problemen.“ Darauf ist sie stolz. „Man kann alt werden wie ‘ne Kuh“, sagt Christina Merseburger lächelnd, „man lernt immer dazu.“
Anmerkung: Hierbei handelt es sich um einen der seltenen Fälle, bei denen weder Psychotherapie noch Antidepressiva ausreichend wirken.
Karl Heinz Möhrmann (77 Jahre, Angehörigen-Perspektive) und seine an einer bipolaren Störung erkrankte Ehefrau Erika (75)
Karl Heinz Möhrmann weiß schon früh, wo es beruflich einmal hingehen soll. Nach dem Abitur studiert er Elektrotechnik. Es folgen 35 erfolgreiche Jahre als Elektroingenieur bei Siemens. Er hält Vorträge in aller Welt zu seinem Fachgebiet Nachrichtentechnik und darf sich über mehr als 60 eigene Patente freuen. Bei einem Faschingsfest lernt er seine spätere Frau Erika kennen. Geheiratet wird 1967.
Bereits ein Jahr später verändert sie sich auffallend, berichtet er. Von ihrer liebenswürdigen und offenen Art, die ihn so angezogen hatte, ist oft nichts mehr zu spüren. Sie beschimpft ihren Mann, überschüttet ihn mit schweren Vorwürfen – für ihn kaum zu ertragen. Irgendwann sucht er einen Scheidungsanwalt auf. Bevor es allerdings zu rechtlichen Schritten kommt, gerät die Situation aus den Fugen. Karl Heinz Möhrmann muss seine Frau in die stationäre Psychiatrie bringen. Dort erfährt er zum ersten Mal, dass es kein schlechter Charakter sei, der zu ihrem Verhalten geführt habe. Seine Frau Erika sei vielmehr krank und befinde sich gerade in einer akuten Manie. Die Diagnose lautet "Bipolare affektive Störung". Eine Scheidungsklage zieht er zurück. „Ich bin heute noch froh über diese Entscheidung“, sagt er.
Bei der bipolaren affektiven Störung wechseln sich depressive Phasen tiefster Verzweiflung mit jenen der maßlosen Euphorie ab. Zunächst hilflos steht der Ehemann vor seiner Frau, versucht diese unterschiedlichen Extreme zu verstehen. Mal ist sie in der Manie übermäßig „heiter“, dann wieder extrem aggressiv. In der depressiven Phase ist sie dagegen hilflos und völlig inaktiv. Ihren Alltag kann sie dann nicht mehr bewältigen, so dass ihr Ehemann alle Aufgaben, wie Einkaufen, Kochen oder die Kommunikation nach außen übernehmen muss. Bis heute war sie mittlerweile 17-mal in stationärer Behandlung. Karl Heinz Möhrmann beginnt damals, sich mit der Erkrankung seiner Frau Erika intensiv zu beschäftigen, schließt sich einer Selbsthilfegruppe an, besucht Seminare. „Heute spüre ich“, sagt der heute 77-Jährige, „wenn meine Frau im Begriff ist, in eine depressive oder manische Phase zu rutschen.“ Sie beraten sich dann mit dem Psychiater, ändern gegebenenfalls in Absprache mit ihm die Medikamentendosis. Inzwischen sei seine Frau medizinisch aber einigermaßen gut eingestellt, wie er sagt, was jedoch keine Garantie dafür sei, nicht einen Rückfall zu erleiden. „Wir haben über die Jahrzehnte hinweg viele sehr schwierige, aber auch viele gute Zeiten zusammen durchlebt, welche ich nicht missen möchte - wie z. B. unsere gemeinsamen Reisen.“, resümiert Karl-Heinz Möhrmann. Er liebt seine Frau bis heute.
Die Selbsthilfe war und ist für ihn von besonderer Bedeutung. Dort findet er Gesprächspartner, alle mit ähnlichen Sorgen und Problemen. Inzwischen leitet Möhrmann den Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e. V. und ist zugleich stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker e. V. Er berät andere Angehörige, gibt Erfahrungen weiter, hält Vorträge. Die Erfolgserlebnisse im Ehrenamt und das Gefühl, etwas bewegen zu können, seien Energiequellen für ihn, sagt er. Sie tun ihm gut. Er begleitet seine Frau weiterhin in jeder Phase, nicht jedoch bis zur Selbstaufgabe, erklärt er. Das sei ganz wichtig.
Sein Rat für Angehörige: „Knüpfe dir ein Hilfenetz aus Maschen und Knoten, jeder Knoten ist ein Mensch. Denn Du wirst nicht immer alleine mit den Problemen fertigwerden. Und tue Dir selbst jeden Tag etwas Gutes. Denn wenn es Dir selbst schon schlecht geht, kannst Du auch für deinen erkrankten Angehörigen nichts mehr tun – dann ist gar niemand geholfen!"
Mehr Informationen zum Thema
Info-Telefon Depression
Das kostenfreie Info-Telefon Depression bietet Betroffenen und Angehörigen Informationen rund um das Thema Depression sowie Hinweise zu Anlaufstellen.
Tel.: 0800 - 33 44 5 33
Mo, Di und Do 13:00-17:00 Uhr; Mi und Fr 8:30-12:30 Uhr