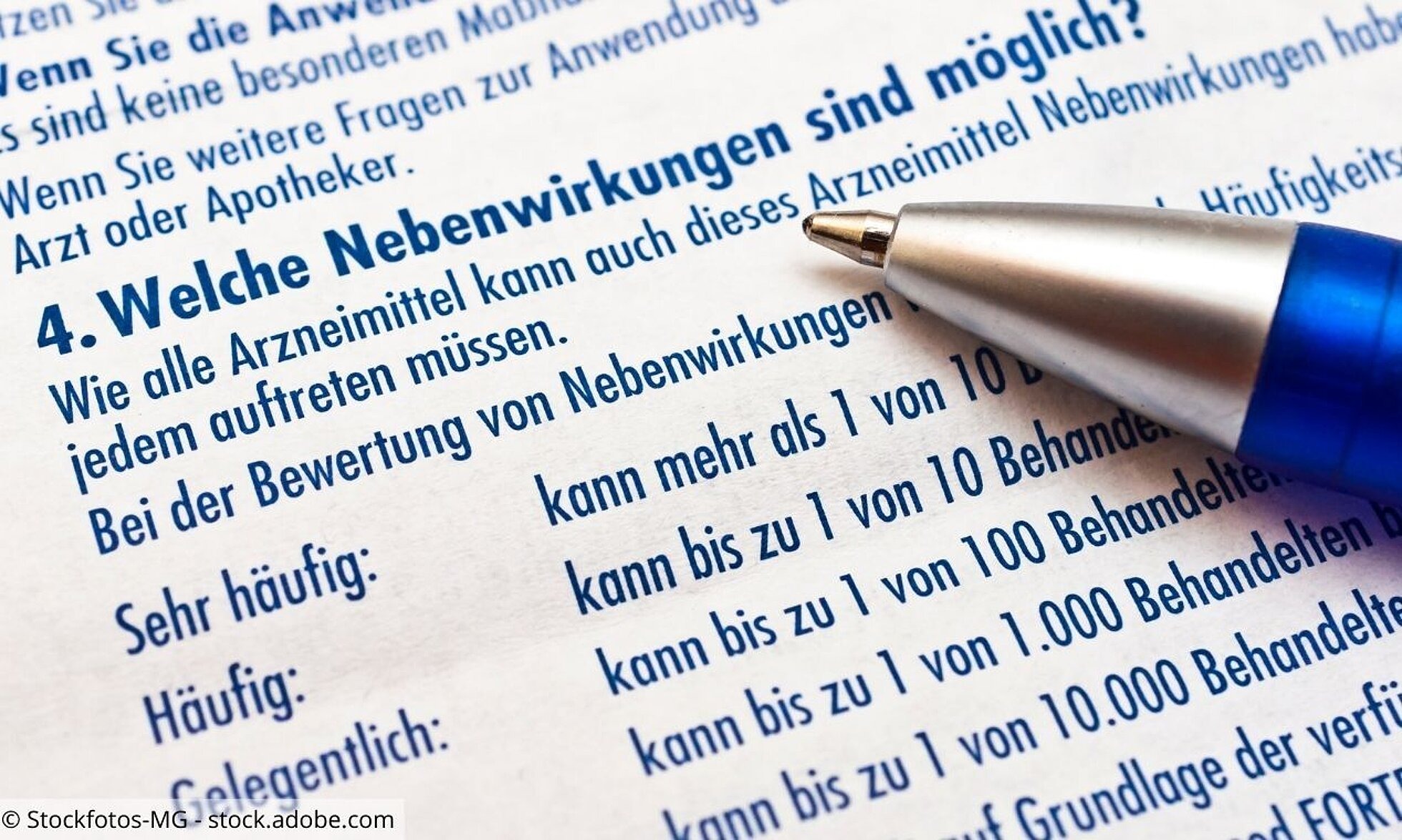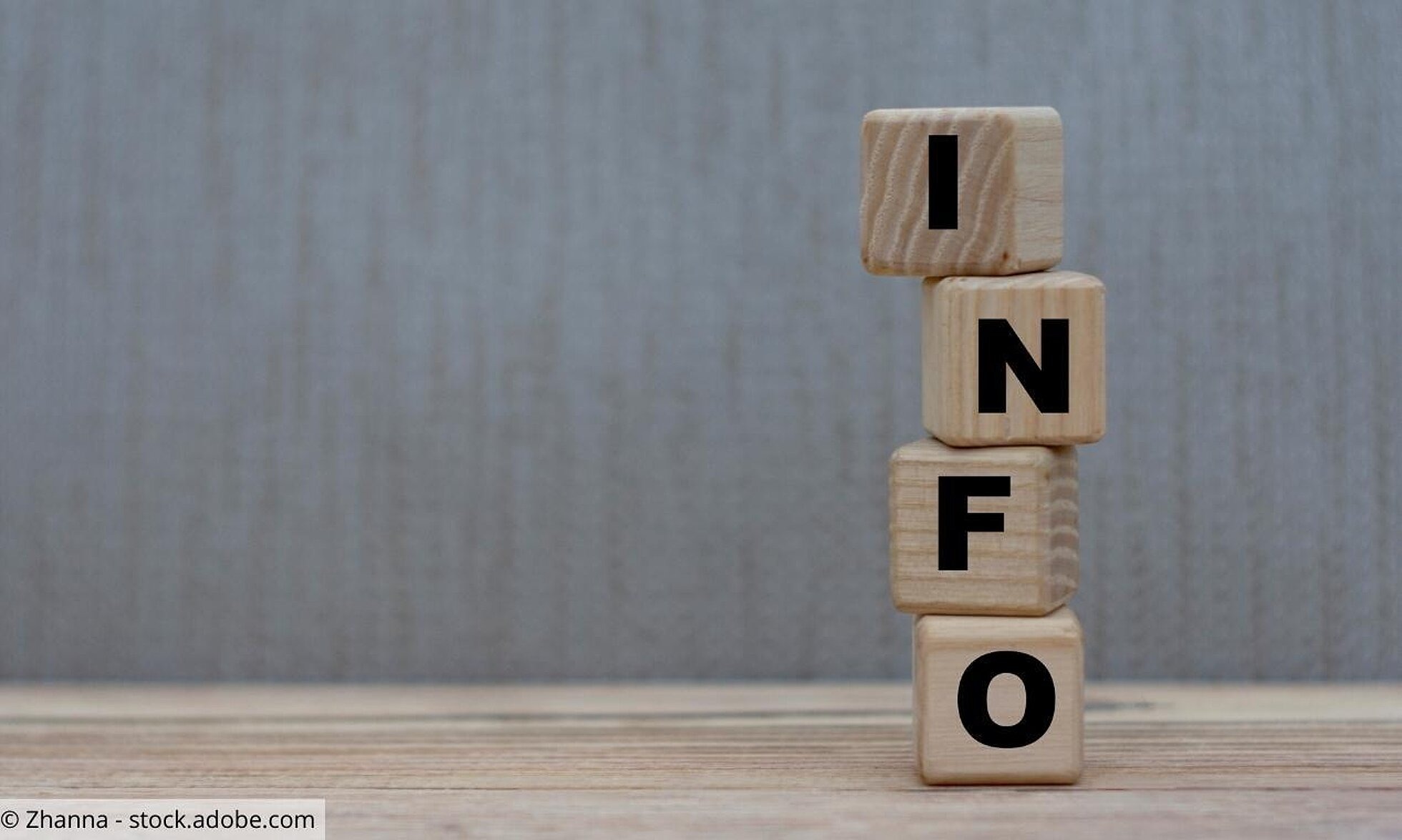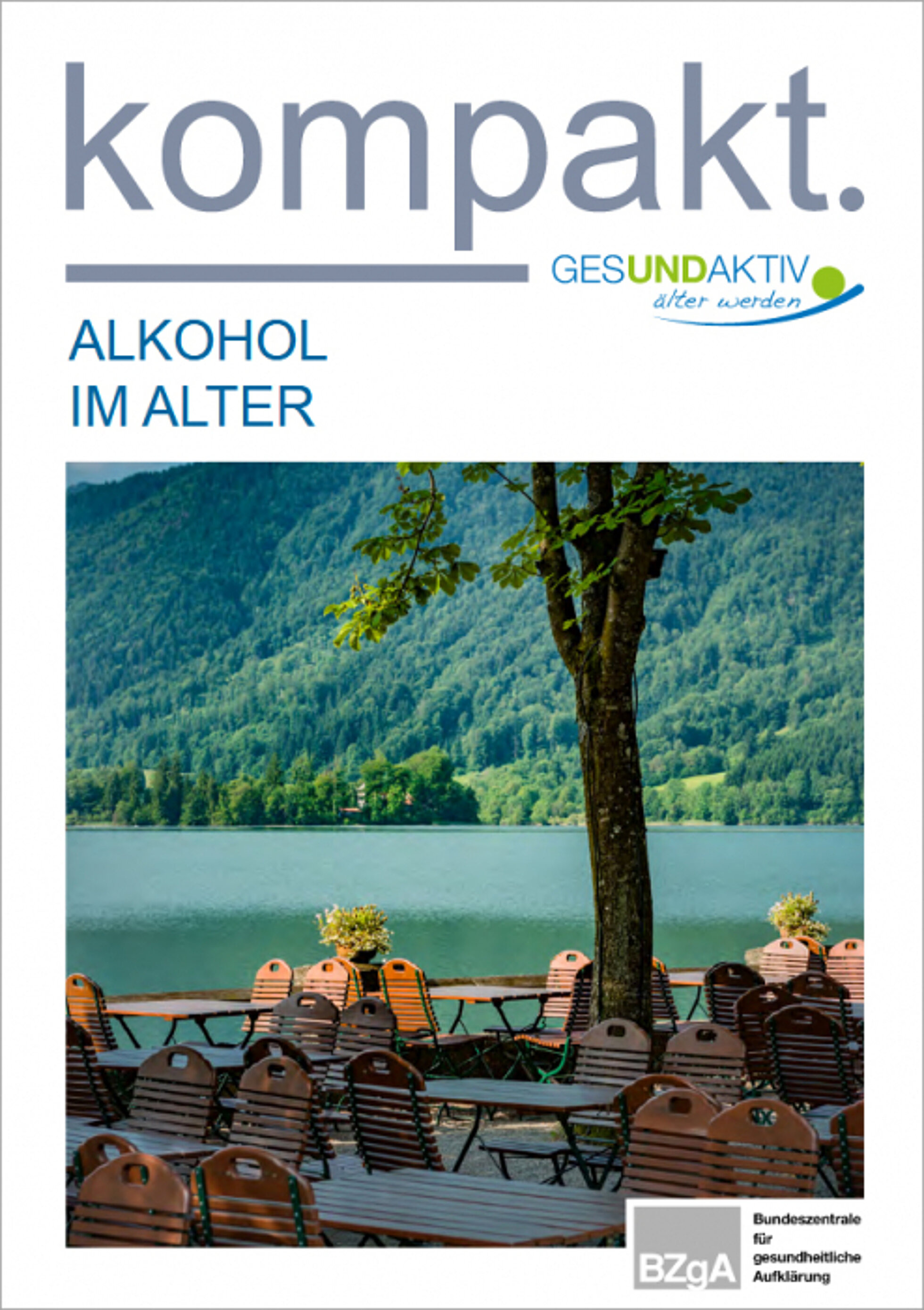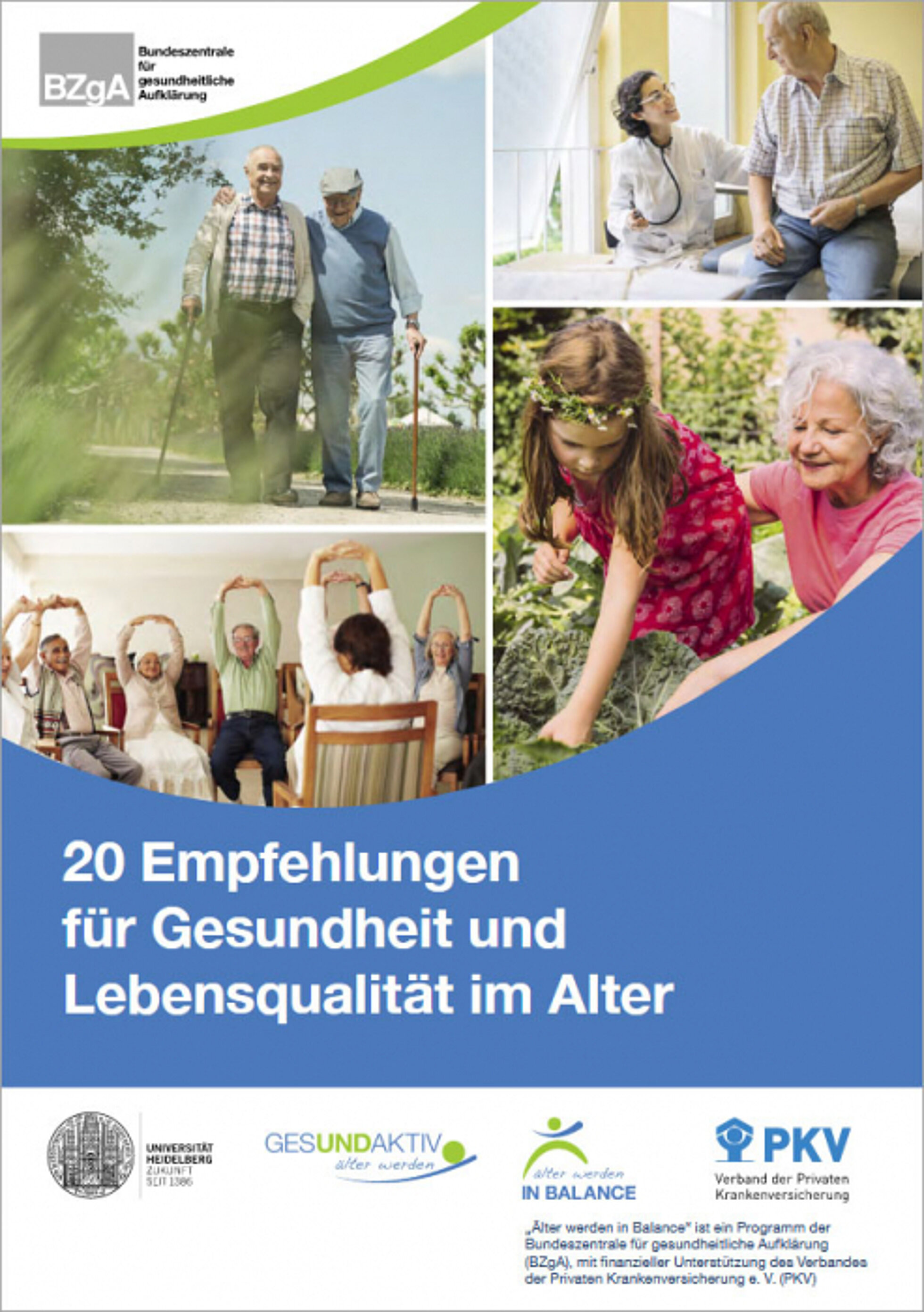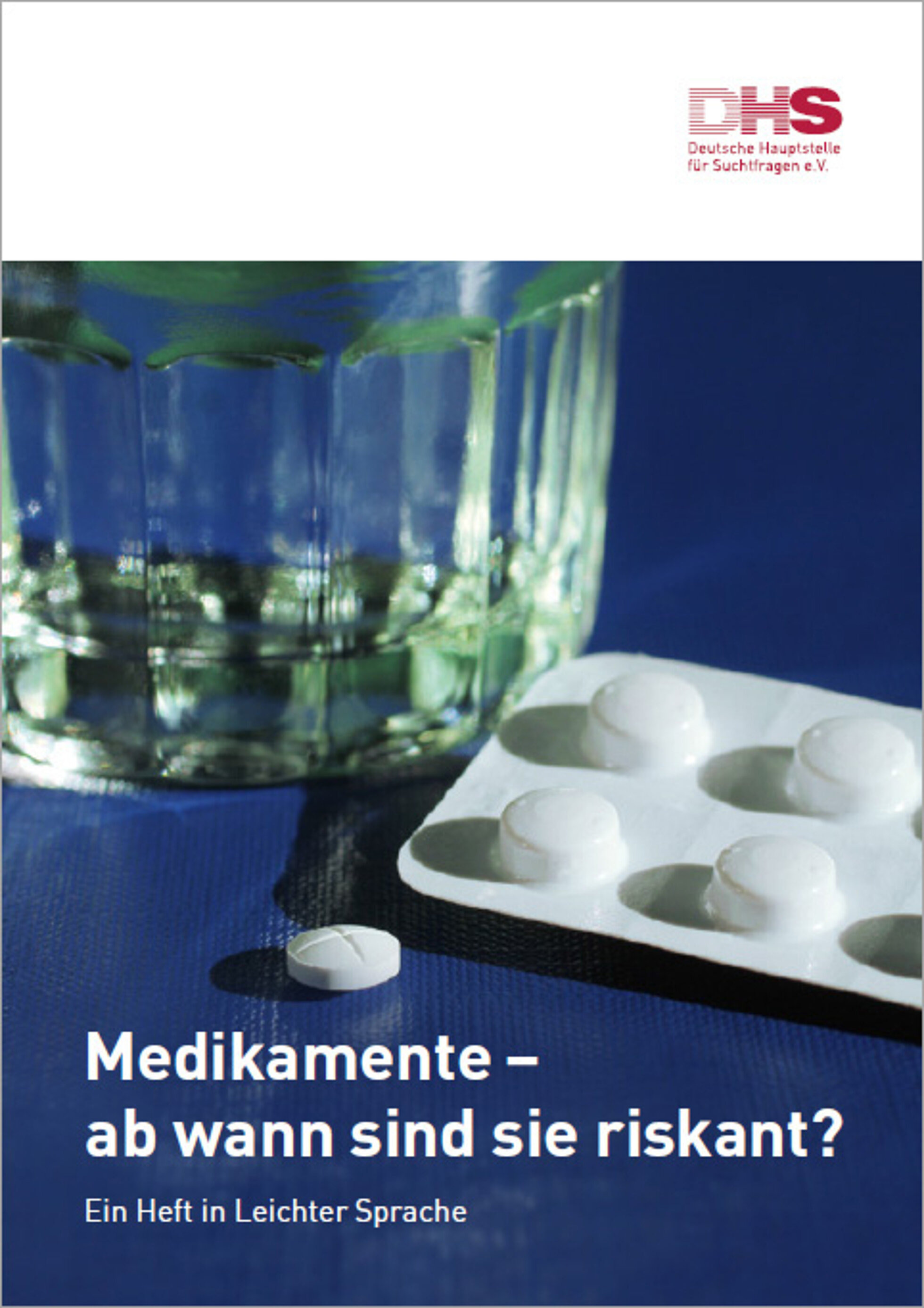Jährlich werden in Deutschland rund 1,4 Milliarden Arzneimittelpackungen in Apotheken verkauft, von denen knapp 45 Prozent nicht rezeptpflichtig sind. Etwa vier bis fünf Prozent aller verordneten Arzneimittel besitzen ein Missbrauchs- oder Abhängigkeitspotenzial. Dazu gehören vor allem verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel.
Bei schätzungsweise 2,9 Millionen Menschen in Deutschland liegt ein problematischer Medikamentenkonsum vor. Besonders gefährdet eine Abhängigkeit von Medikamenten zu entwickeln, sind Menschen ohne greifbares Krankheitsbild und mit vielfältigen Beschwerden. Dazu gehören beispielsweise Überforderungs- oder Überlastungsgefühle, Schwindel, Herzrasen, Magen-Darm-Probleme oder Schlafstörungen äußern.
Gut schlafen
Bei manchen Schlafproblemen müssen es nicht gleich Medikamente sein. Bereits einfache Verhaltensregeln können helfen.
Medikamentenmissbrauch und -abhängigkeit erkennen
Häufig werden der Missbrauch oder die Abhängigkeit von Medikamenten von den Betroffenen nicht als solche wahrgenommen. Gründe dafür sind unter anderem,
- dass Medikamente mit Missbrauchs- bzw. Abhängigkeitspotenzial unter die Verschreibungspflicht fallen. Betroffene Personen sehen die Einnahme ihrer Medikamente als begründet an, da sie ärztlich verordnet sind.
- dass viele Medikamente über das Internet oder Apotheken auch ohne ärztliches Rezept erhältlich sind und somit unkontrolliert eingenommen werden. Gerade Medikamente, wie Nasentropfen und -sprays, Abführmittel oder Schmerzmittel, die keine körperlichen Entzugserscheinungen auslösen, haben ein hohes Risiko, nicht bestimmungsgemäß angewendet zu werden.
Achten Sie deshalb auf Hinweise in der Gebrauchsinformation der Medikamente und wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt bzw. Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker.
Unterscheidung zwischen Missbrauch und Abhängigkeit
Ein Missbrauch von Medikamenten kann vorliegen, wenn diese
- für einen anderen Zweck als eigentlich bestimmt,
- in höherer Dosis als verordnet,
- länger als verschrieben oder
- in einer anderen Anwendungsform als vorgesehen,
eingenommen werden.
Eine Abhängigkeit von Medikamenten kann bestehen, wenn irgendwann während des letzten Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien vorhanden waren:
- starker Wunsch oder eine Art Zwang, das Medikament einzunehmen
- Kontrollverlust über Beginn und Ende der Einnahme bzw. der Menge des Medikaments
- körperliche Entzugserscheinungen bei Absetzen oder Verringern des Medikaments
- die Einnahme immer höherer Dosen, um die gewünschte Wirkung zu erreichen
- die Vernachlässigung von Interessen, da immer mehr Zeit notwendig ist, um sich das Medikament zu beschaffen, einzunehmen oder sich von den Folgen der Einnahme zu erholen
- die anhaltende Einnahme des Medikaments, obwohl den Betroffen die schädlichen Folgen bewusst sind
Der Abhängigkeit geht in der Regel ein Missbrauch voraus, wohingegen ein Missbrauch nicht zwangsläufig in eine Abhängigkeit mündet. Allerdings sind die Grenzen fließend. Häufig liegt auch eine sogenannte Niedrigdosisabhängigkeit vor. Dadurch wird es schwerer eine Abhängigkeit festzustellen.
Medikamentenmissbrauch am Arbeitsplatz
Hirndoping (pharmakologischen Neuroenhancement oder auch cognitive enhancement) bezeichnet den Gebrauch von psychoaktiven Substanzen durch Gesunde. Erkrankungen, die die Einnahme solcher Medikamente erfordern würden, liegen also nicht vor. Diejenigen, die solche Mittel einnehmen, verbinden damit den Wunsch, die Verbesserung geistiger Leistungsfähigkeit wie beispielsweise Kreativität, Auffassungsgabe und Erinnerungsvermögen zu erhöhen.
Laut Studien nehmen etwa 2 Prozent der Beschäftigten regelmäßig Medikamente ein, um ihre kognitiven Fähigkeiten und ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 60 und 65 Jahren greifen auf Medikamente zurück, um ihr Leistungsvermögen zu steigern.
Allerdings halten die Medikamente nicht das, was ihnen nachgesagt wird. Insbesondere bei gesunden Menschen ist eine Wirkung der Leistungssteigerung in der Regel nicht vorhanden. Hinzu kommen mögliche unerwünschte Nebenwirkungen und fehlende Daten zur langfristigen Sicherheit.
Medikamente mit Risiko
Sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente im Rahmen der Selbstmedikation können ein mehr oder weniger ausgeprägtes Missbrauchspotenzial aufweisen. Bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente können zudem ein Risiko zur Abhängigkeitsentwicklung mit sich bringen. Bei manchen apothekenpflichtigen Medikamenten ist ebenfalls Vorsicht geboten. Sie machen zwar nicht abhängig, können bei Missbrauch aber zu gesundheitlichen Problemen führen.
Beispiele für verschreibungspflichtige Medikamente
stark wirksame Schmerzmittel
- wie Morphin, Codein, Hydromorphon, Oxycodon, Tilidin
- Folgen bei Abhängigkeit: labile Stimmungslage, Schlaflosigkeit, Abmagerung, Impotenz, Koordinationsstörungen, Unruhe, Depressionen, Angstzustände, Herz-Kreislauf-Probleme, Magen-Darm-Beschwerden, Muskelkrämpfe
Schlaf- und Beruhigungsmittel
- wie Diazepam, Oxazepam, Flurazepam, Triazolam, Zopiclon und Zolpidem
- Folgen bei Abhängigkeit: ohne Medikament treten alle Symptome wieder auf, weswegen es eingenommen worden ist, teilweise sogar verstärkt: Angst, Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen
Aufputschmittel
- wie Methylphenidat, Atomoxetin, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin
- Folgen bei Abhängigkeit: Erschlaffungsgefühle, Katerstimmung, vermehrte Reizbarkeit und Aggressivität, depressive und ängstliche Syndrome
Appetitzügler
- gehören zur Gruppe der Amphetamine
- Folgen bei Abhängigkeit: Erschöpfungszustände, depressive Erscheinungen, Schlafstörungen, Probleme Herz-Kreislaufsystems
Beispiele für apothekenpflichtige Medikamente
Abführmittel
- wie Bisacodyl, Glycerol, Glaubersalz
- Folgen bei Missbrauch: Verstärkung der Darmträgheit, Mineralstoffverlust (insbesondere Kalium) mit daraus resultierenden Herzrhythmusstörungen und Muskelschwäche, krampfartige Magen-Darm-Beschwerden sowie Darmreizungen
Nasentropfen und -sprays
- mit Wirkstoffen wie beispielsweise Xylometazolin, Oxymetazolin
- Folgen bei Missbrauch: Medikamentenbedingter „Schnupfen“, Austrocknen der Nasenschleimhaut
Schmerzmittel
- wie beispielsweise Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen, Paracetamol, Naproxen
- Folgen bei Missbrauch: medikamentenbedingter Dauerkopfschmerz, gesteigertes Blutungsrisiko, Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Geschwüren, schwere Leberschäden, Schädigung der ableitenden Harnwege und der Niere
Abhängigkeit vermeiden
Um einem Missbrauch oder einer Abhängigkeit vorzubeugen, braucht es einen sorgfältigen Umgang mit entsprechenden Medikamenten. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, Sie über mögliche Risiken verständlich aufzuklären. Zudem sollte sich Ihre Ärztin oder Ihr Arzt immer wieder bei Ihnen vergewissern, welche Medikamente Sie zusätzlich einnehmen. Dadurch kann verhindert werden, dass Sie mehrere Medikamente mit Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial von unterschiedlichen Ärztinnen oder Ärzten erhalten. Personen mit einer Abhängigkeit in der Vorgeschichte sollten besonders vorsichtig sein.
Wenn Sie bei Medikamenten unsicher sind, zögern Sie nicht, bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt nachzufragen. Sie können auch eine Vertrauensperson bitten, bei dem Gespräch anwesend zu sein.
Worauf Sie achten sollten
Bei Medikamenten wie Schlaf- oder Beruhigungsmittel, hilft Ihnen die sogenannte 4-K-Regel eine Abhängigkeit zu vermeiden:
- Klare Indikation: Nehmen Sie das Medikament nur ein, wenn es einen klaren medizinischen Grund gibt. Besprechen Sie diesen und mögliche Alternativen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Lassen Sie sich über mögliche Risiken aufklären.
- Korrekte Dosis: Nehmen Sie nur ein, was unbedingt notwendig ist. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über kleinste mögliche Dosierung.
- Kurze Anwendung: Betrachten Sie das Medikament als Überbrückung und nehmen sie es nur so kurz wie möglich ein. Bereits nach 3 bis 4 Wochen kann sich eine Abhängigkeit einstellen. Vereinbaren Sie einen kurzfristigen Nachfolgetermin bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
- Kein abruptes Absetzen: Beenden Sie die Einnahme des Medikamentes nicht schlagartig, sondern sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über eine langsame Verringerung der Dosis.
Weitere Informationen und Tipps finden Sie in der Broschüre „Medikamenteneinnahme: Risiken vermeiden - 4-K-Regel“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Medikamente und Sucht
Die Webseite der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. informiert über Hintergründe, Risiken, besonders gefährdete Personengruppen und über die Medikamente, die abhängig machen können.